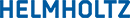URL: https://www.desy.de/aktuelles/news_suche/index_ger.html
Breadcrumb Navigation
DESY News: Künstlicher Mini-Antikörper gegen das Coronavirus
News-Suche
Meldungen vom Forschungszentrum DESY
Künstlicher Mini-Antikörper gegen das Coronavirus
Über das Screening hunderter synthetischer Mini-Antikörper hat ein Forschungsteam einen vielversprechenden Kandidaten aufgespürt, der die Infektion mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 stoppen könnte. Mit Hilfe von DESYs Röntgenlichtquelle PETRA III konnte das Team entschlüsseln, wie dieser sogenannte Sybody mit dem Virus interagiert. Die Forscherinnen und Forscher der Hamburger Außenstelle des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie EMBL, des Zentrums für Strukturelle Systembiologie CSSB bei DESY und anderer Institutionen stellen ihre Ergebnisse im Fachblatt „Nature Communications“ vor.

Nanobodys sind kleine Antikörper, die bei Kamelen und Lamas vorkommen. Sie sind nicht nur klein, sondern auch sehr stabil und daher vielversprechend für den Einsatz gegen Viren. Die Gewinnung aus Tieren ist zeitaufwändig, aber dank des technischen Fortschritts gibt es inzwischen Bibliotheken synthetischer Nanobodys, sogenannter Sybodies. Eine Technologieplattform, die im Labor von Markus Seeger an der Universität Zürich entwickelt worden ist, erlaubt die schnelle Auswahl von Sybodys aus großen synthetischen Bibliotheken und wurde für diese Studie zur Verfügung gestellt.
Die EMBL-Gruppe von Christian Löw durchsuchte damit die bestehenden Bibliotheken nach Sybodys, die SARS-CoV-2 an der Infektion menschlicher Zellen hindern könnten. Dabei benutzten sie die fingerartigen RBDs des viralen Spike-Proteins als Köder, um diejenigen Sybodys auszuwählen, die daran binden. Als nächstes testeten sie die ausgewählten Sybodys auf Stabilität, Wirksamkeit und Präzision der Bindung. Ein syntehtischer Antikörper mit der Bezeichnung Sybody 23 erwies sich als besonders wirksam bei der Blockade der RBDs.
Um zu erkunden, wie Sybody 23 genau mit den viralen RBDs interagiert, untersuchte die Gruppe von EMBL-Forscher Dmitri Svergun diese Bindung an DESYs Röntgenlichtquelle PETRA III, an der das EMBL eigene Messstationen betreibt. Das helle Röntgenlicht kann die atomaren Details solcher Biomoleküle sichtbar machen. Darüber hinaus analysierte das Team von Martin Hällberg vom CSSB und dem schwedischen Karolinska Institut die Struktur der Bindung zwischen Sybody 23 und dem Spike-Protein des Coronavirus per Kryo-Elektronenmikroskop.
Die RBDs wechseln zwischen zwei Positionen: In der einen Position zeigen die RBDs nach außen und sind damit bereit, an das menschliche ACE2-Protein zu binden. In der anderen Position sind sie dagegen zusammengerollt, um sich vor dem menschlichen Immunsystem zu verstecken. Die Strukturuntersuchungen zeigten, dass sich Sybody 23 in beiden Positionen an die RBDs bindet und sie so blockiert. Das könnte erklären, warum Sybody 23 im Labor so wirksam ist.
Um zu testen, ob Sybody 23 tatsächlich ein Virus neutralisieren kann, verwendete die Gruppe von Ben Murrell vom Karolinska Institutet ein anderes Virus, das sogenannte Lentivirus. Es wurde genetisch so modifiziert, dass es das Spike-Protein von SARS-CoV-2 auf seiner Oberfläche ausbildet. Die Forscherinnen und Forscher konnten beobachteten, dass Sybody 23 das modifizierte Virus im Reagenzglas erfolgreich deaktivierte. Das Projekt hat damit einen vielversprechenden Kandidaten zur Behandlung von COVID-19 identifiziert. Ob der synthetische Antikörper allerding auch im menschlichen Körper die Infektion stoppen kann und sich als Medikament eignet, müssen erst weitere Untersuchungen zeigen.
Originalveröffentlichung:
Selection, biophysical and structural analysis of synthetic nanobodies that effectively neutralize SARS-CoV-2; Tânia F. Custódio, Hrishikesh Das, Daniel J Sheward, Leo Hanke, Samuel Pazicky, Joanna Pieprzyk, Michèle Sorgenfrei, Martin Schroer, Andrey Gruzinov, Cy Jeffries, Melissa Graewert, Dmitri Svergun, Nikolay Dobrev, Kim Remans, Markus A. Seeger, Gerald McInerney, Ben Murrell, B. Martin Hällberg and Christian Löw; „Nature Communications“, 2020; DOI: 10.1038/s41467-020-19204-y
Quelle: EMBL